Monat: Dezember 2016

Schmerzfrei ausklingen lassen
Eine Auflage aus geriebenem Kren Sag zum Abschied leise: Servus – Anno Domini 2016! Wohl oder übel wendet sich die Zeit und wieder ist ein Jahr dahin. Wer es zusammenbringt, den Dank bei der Rückschau auf die verflossenen Monate die Read more...
...
Eine zielführend scharf Kur
Der Rettich verzögert die Gallensteinbildung Auf meinem Weg, den ich mehrmals pro Woche zwischen meinem Kloster Geras und dem Sitz des Vereines der Heilkräuter in Karlstein zurücklege, befindet sich nahe des Dorfes Eibenstein an der Thaya ein Steinbruch. Immer wieder Read more...
...
Beerenstarkes Bad
Zur Abwechslung einmal mit Weißdorn Der Begriff der Schönheit wurde seit Menschengedenken auf vielfache Weise aufgegriffen, um einerseits umgesetzt und anderseits in seiner Bedeutung philosophisch analysiert zu werden. Selbst in der Theologie verwendeten viele dieses Ideal im Hinblick auf die Read more...
...
Flüssige Wohltat
Dem Holundersaft öfter zusprechen Ist schon alles eingekühlt, damit der Jahreswechsel gut vonstatten gehen kann? Wenn man das ganze Jahr über vielleicht kaum Gelegenheit hatte, einen guten Schluck Sekt nach dem üblichen Zuprosten zu trinken: zu Silvester sollte spätestens dieser Read more...
...
Die Atmosphäre verändern
Ätherisches Wacholder-Öl bremst Keime Von einem Ort zum anderen zu kommen, ist heutzutage mit keinen großen Anstrengungen verbunden. Technische Hilfsmittel aller Art machen ein Weiterkommen im Handumdrehen möglich. Somit stellt ebenfalls das Transportieren jeglichen Dinges – egal, ob groß oder Read more...
...
Der etwas andere Christbaum
Der Apfelbaum zur Winterszeit Gehen wir zurück in mittlerweile längst vergangene Jahrzehnte, so wissen wir aus den Erzählungen unserer Großeltern, dass es in den von den Weltkriegen geprägten Zeiten viel karger herging als im gegenwärtigen Wohlstandsgewoge. Abgesehen von den nächtens Read more...
...
Löffelweise aufpäppeln
Gedörrte Birnen ergänzen Eisenmangeln Das Weihnachtsfest bringt eine im wahrsten Sinne des Wortes häusliche Zeit mit sich. Wenn schon das übrige Jahr über der Aufenthalt berufsbedingt oft weit weg von daheim sein muss, so darf doch die mit den Feiertagen Read more...
...
Den Frieden finden
Die Galle mit Odermennig beschicken Weihnachten wird je neu als ein Fest des Friedens bezeichnet. Wie sehr das seine Berechtigung hat, mag angesichts der schwelenden Konflikte im Globalen wie auch im kleineren Kontext etwa der Familien dahingestellt bleiben. Frieden ist Read more...
...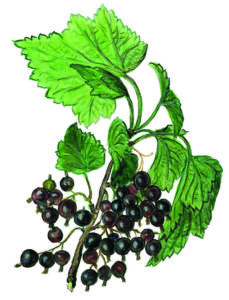
Die Familie versammeln
Rund um die Blätter der Schwarzen Ribisel Wir gehen einer wichtigen Zeit entgegen. Weihnachten steht vor der Tür und mit diesem wunderschönen Fest womöglich auch die einzelnen mittlerweile flügge gewordenen Kinder der eigenen Familie, die oft weit weg von zu Read more...
...
In den hinteren Reihen angesiedelt
Die Bibernelle dennoch wertschätzen Die privilegierten Sitze bei Veranstaltungen und in Räumen sind nicht immer gleich positioniert. Ist z. B. bei einem öffentlichen Event eine hochrangige politische Persönlichkeit der Ehrengast, wird diese wohl ganz vorne den reservierten Platz einnehmen. Im Read more...
...
