Monat: September 2017

An die Luft setzen
Die Eberraute für die Zimmeratmosphäre Wie in jeder Sprache, so gibt es auch im Deutschen Vokabel, die eine mehrfache Bedeutung besitzen. So weist die Bezeichnung Eber für sich isoliert auf das männliche Schwein hin. Doch in einer Zusammenfügung sieht das Read more...
...
Entwässern und abnehmen
Sellerie kann das unterstützen Eine Kost mit einem hohen vegetarischen Anteil ist wohl nie zu verachten. Zwischendurch kann dies immerhin zu einer Ausgewogenheit unserer Ernährung maßgeblich beitragen. Wenn nun schon das grüne Blatt und das frische Gemüse am Teller dominieren, Read more...
...
Straffende Maßnahme
Heidelbeer-Blätter für die Haut Für die eigene Gesundheit und das damit verbundene Wohlbefinden gibt es Indikatoren, die über das Empfinden und das Aussehen Auskunft über den jeweiligen Zustand erteilen können. Wenn man auch selbst vielleicht meint, dies verbergen zu können, Read more...
...
Lindernde Auflagen
Das Eisenkraut als Hilfe Pflanzen sind im Prinzip vielmehr Lebensbegleiter als kurzfristig herbeigerufene Nothelfer, die man mit unseren Blaulichtorganisationen vergleichen könnte. Gewiss kann man sich auch spontan und vorübergehend die Wirkstoffe des phytotherapeutischen Angebotes zunutze machen. Doch braucht es bei Read more...
...
Freien Atem schaffen
Zur Alantwurzel greifen Jeder hat schon einmal die Erfahrung gemacht, dass man nur wenig Zeit hat, um an ein Ziel zu gelangen. Sprich: man hat es eilig. Ist man dabei mit dem Auto unterwegs, kann es leicht passieren, dass eine Read more...
...
Duftendes Tonikum
Mit dem Lavendel das Gemüt stärken Was vom Sommer zurückbleibt, das sind u. a. schöne Erinnerungen, festgehalten auf Fotos vom Urlaub oder einem Treffen mit Freunden daheim. Es sind aber auch Düfte und Aromen damit verbunden, die uns allen sehr Read more...
...
Die Hagebutten aufarbeiten
Die Reste ebenfalls verwerten Die Überlegungen, was man anlässlich der vielfachen Fruchtreife mit dem Vorhandenen im Garten und darüber hinaus in der freien Natur anfangen soll, führt automatisch dazu, das verfügbare Obst und Gemüse in irgendeiner Weise aufzuarbeiten und damit Read more...
...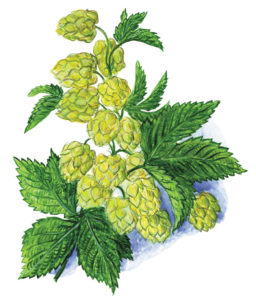
Den Schlaf unterstützen
Der Hopfen steht bereit Beim Einkaufen sollte man auf Verschiedenstes achten. Das betrifft nicht nur die Preise und das dafür vorhandene Geld, sondern vor allem die Qualität der Produkte. Vieles ist mit sogenannten Konservierungsmitteln versetzt, um eine bestimmte Haltbarkeit zu Read more...
...
Aktuelle Kur
Weintrauben für den Darm Die Redewendung „Alles zu seiner Zeit!“ ist wohl den meisten bekannt. Das meint, dass man ein wenig Geduld aufbringen darf, um vieles, was ansteht, zu erledigen bzw. den richtigen Moment abwartet, um an das begehrte Gut Read more...
...
Durchaus dran hängen bleiben
Bei der Klette zur Wurzel vordringen Haustiere sind liebenswerte Zeitgenossen, die einem das Leben sehr bereichern können. Vielen einsamen Menschen bieten sie ein Gegenüber, das zur Bewältigung der Tage immens wichtig sein kann. Und sie brauchen Pflege. Hat man z.B. Read more...
...
